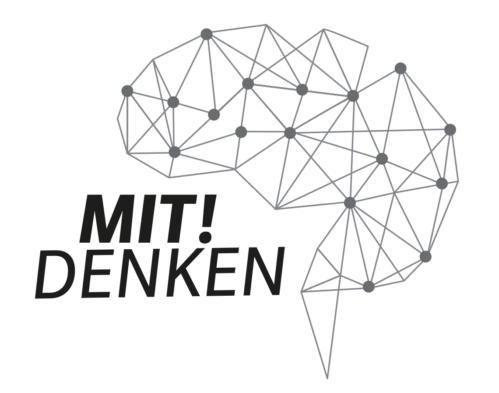I. Von der Corona-Krise
Ein Virus mit dem schönen Namen „Corona“ (medizinisch offenbar korrekter aber weniger ansprechend: SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus 2) hat die Welt verändert. Seitdem die Ausbreitung der virusbedingten Krankheit (namens COVID-19) ein pandemisches Ausmaß angenommen hat, scheint kaum mehr etwas so zu sein wie zuvor. Die Welt befindet sich im Krisenmodus. Der Ausdruck „Corona-Krise“ beschreibt dabei nicht nur die unmittelbaren medizinischen Folgen der Erkrankung (mit weltweit mehreren hunderttausend Toten). Mit dieser Bezeichnung werden zugleich auch die bereits eingetretenen und absehbaren Konsequenzen in juristischer, ökonomischer, politischer und sozialer Hinsicht umfasst. Die Komplexität der Problematik lässt es nicht einfach erscheinen, sich dazu zu äußern. Dies gilt nicht nur deshalb, weil es kaum möglich ist, sämtliche Aspekte zu erfassen. Wer sich zu Äußerungen hinreißen lässt, kann jeweils nur einen kleinen Ausschnitt der Problematik ansprechen. Zwar haben zunächst die Virologen die Meinungshoheit erobert, für die Gesamtheit der Probleme genügt allerdings der medizinische Sachverstand allein ebenso wenig wie eine lediglich politische oder ökonomische Beurteilung. In beinahe jeder Hinsicht sind noch zu viele Unklarheiten zu verzeichnen. Der Umgang mit der Unwissenheit begünstigt bisweilen die jeweils schlimmste der verfügbaren Annahmen. Die führt zu einer großen Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung. Wahrscheinlich kann – wenn überhaupt – erst im Nachgang der Pandemie geklärt werden, woran es beispielsweise liegen mag, dass die Auswirkungen der Erkrankung sowohl individuell als auch geographisch stark variieren. Während die Virusinfektion bei den allermeisten der betroffenen Menschen zum Glück nur einen recht milden Verlauf nimmt, muss eine prozentual verhältnismäßig kleine Anzahl von Betroffenen mit schweren Folgen kämpfen; bei einem geringen Prozent- bzw. Promillesatz verläuft die Krankheit sogar tödlich. Bei einer hohen Infektionsrate (inklusive einer unbekannten Dunkelziffer) ist die Anzahl an Toten in die genannte Höhe geschnellt.
Auch die nationalen bzw. sogar regionalen Unterschiede sind schwer erklärlich. Allein die Art der Maßnahmen kann die unterschiedlich hohen Todesraten nicht erklären. So ist in manchen Ländern (namentlich Italien, Spanien und Frankreich), die sowohl schneller als auch mit drastischeren Maßnahmen (wie z.B. strikten Ausgangssperren) reagiert haben, eine viel höhere Anzahl an Todesfällen zu beklagen, als etwa in Deutschland, wo es lediglich zu allgemeinen Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen (u.a. in Bayern) gekommen ist. Selbst in Schweden, wo im Vergleich zum restlichen Europa ein Sonderweg ohne weitgehende Stilllegungen des öffentlichen Lebens eingeschlagen worden ist, kam es nicht zu der befürchteten exponentiellen Ausbreitung. Bislang wird wohl vermutet, dass die unterschiedlichen Todeszahlen u.a. mit der Anzahl an Tests zusammenhängen, durch die gezielte Reaktionen (etwa die Verhängung einer Quarantäne und der darauf folgenden Unterbrechung der Infektionsketten) ermöglicht werden. Zudem könnte auch der unterschiedlich distanzierte Lebensstil in den Ländern eine Rolle spielen. Außerdem scheint die Qualität der Gesundheitssysteme zu variieren. Das Virus trifft auf Bevölkerungen mit einer unterschiedlichen Quote von Vorerkrankten.
Das Corona-Virus hat allerdings nicht nur viele Menschen erkranken (und sterben) lassen, sondern auch die Debattenkultur infiziert. Beinahe jede Äußerung trifft auf bis in Extreme gespaltene Lager: einerseits gibt es nicht wenige, die in dem Virus den Endgegner der Menschheit erkannt zu haben glauben. Die überall spürbare Angst vor diesem mit bloßem Auge nicht sichtbaren Feind verändert das Verhältnis zu den Mitmenschen. Der Nächste erscheint als potentieller Träger einer tödlichen Gefahr. Im Angesicht des Todes scheint dann fast keine Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie maßlos. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die das Problem als solches leugnen oder eine von wem auch immer inszenierte Komplott dubioser politischer Mächte vermuten. Zwischen panischer Hypochondrie und alberner Verschwörungstheorie sollte es jedoch genügend Platz für das Bemühen um ein angemessenes und besonnenes Verständnis der aktuellen Situation geben.
II. Über die Ausnahmerhetorik
Fraglich ist, ob hierfür das Schlagwort vom Ausnahmezustand behilflich sein kann. Gemeinsam mit dem neuen Virus hat es sich jedenfalls wieder einmal verbreitet. Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand – so lautet eine von vielen gestellte Diagnose. Das ist an sich nichts Neues. Das 21. Jahrhundert ist bislang ohnehin schon als das Jahrhundert der Krisen bekannt, in denen es jeweils zur Ausrufung eines Ausnahmezustandes gekommen ist. Es hat mit den Terrorakten vom 11. September 2001 begonnen, setzt sich fort mit der Finanz-Krise am Ende des ersten Jahrzehnts und führt über die sog. `Flüchtlings-Krise´ von 2015 (samt Folgejahre) bis zur aktuellen `Corona-Krise´. Dazwischen haben wir im Grunde nie zu so etwas wie `Normalität´ zurückgefunden. Obwohl wir die Rede vom Ausnahmezustand inzwischen gewohnt sind, wissen wir noch immer sehr wenig darüber. Jede Ausnahme ist anders. Die Unterschiede lassen keine allgemeingültige Definition zu. Gemeinsam scheint lediglich die negative Konnotation: der Zustand ist eben nicht normal und scheint als solcher unerwünscht zu sein. Um eine generalisierbare Kennzeichnung inmitten der Vielfalt der besonderen Ausnahmezustände zu erlangen, wird nicht selten versucht, eine Ausnahme durch ihr Verhältnis zur Normalität zu bestimmen. Das Normale bzw. die Normen, die einen Normalzustand beschreiben, sollen aber selbst erst durch die Ausnahme bestätigt werden. Nur wer einen Ausnahmezustand erlebt, lernt das Normale zu schätzen. Wie so oft ist es der Verlust des Gewohnten, der ein positives Verständnis davon ermöglicht. Ähnlich wie ein selbst erlittenes Unrecht erst die Vorstellung von Recht präzisiert, so schärft die Erfahrung einer Ausnahmesituation, d.h. das Nicht-Normale, den Blick für die Normalität. Durch das ständige Hin- und Her-verweisen zwischen Regel und Ausnahme gerät man freilich leicht in einen Zirkel. Konkreter geht es meist um eine Relation zu den (rechtlichen) Normen. In all den genannten Krisen ging es jeweils darum, mit der Ausrufung des Ausnahmezustandes die rechtlichen Grenzen des Erlaubten zu verschieben. Auf der einen Seite dieser Grenze werden dann staatliche Befugnisse erweitert, auf der anderen der Gebrauch der (subjektiven) Rechte eingeschränkt. Immerhin wird dadurch deutlich, dass der rechtliche Normalzustand mit der Freiheit der Rechtssubjekte verbunden ist.
1. Ausnahme vom Recht?
Mit der Beziehung zwischen dem Recht der normalen, d.h. der rechtlich normierten Lage und der Ausnahmesituation geht es zugleich auch um das Verhältnis des Rechts zur Politik. In einer Gemeinschaft mit einem normativen Gefüge, das sich als Rechtsstaat definiert, ist – wie der Name schon andeutet – von der Herrschaft des Rechts auszugehen. Hier geht es um die rechtliche Bindung der politischen Entscheidung. Im demokratischen Rechtsstaat ist zudem die die Einhaltung der Gewaltenteilung zu beachten. Insbesondere ist die ordnungsgemäße Setzung des Rechts durch die zuständigen Legislativorgane für die Legitimation staatlichen Handels wesentlich. Dieses Selbstverständnis wird mit dem Schlagwort vom Ausnahmezustand erschüttert. In der Ausnahmelage schlägt die Stunde der politischen Exekutive, die eine rechtlich unbeschränkte Herrschaftsmacht für sich beansprucht. Aus diesem Grund wird der Begriff `Ausnahmezustand´ nicht selten in Zusammenhang mit der Definition der politischen Souveränität gesehen. Der diesbezüglich wohl bekannteste Bestimmungsversuch stammt von Carl Schmitt. Dessen Buch `Politische Theologie´ (zuerst 1922) beginnt mit dem berühmt-berüchtigten Satz: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“. In dieser Konzeption gilt die Souveränität als „höchste, nicht abgeleitete Herrschermacht“, das Recht bzw. die subjektiven Freiheitsrechte hingegen wirken als deren Fessel, die sich die Politik für den Normalfall anlegen lässt. Nur in ruhigen Zeiten könne der Staat die größtmögliche Freiheit der Einzelnen gewährleisten. Mit der Entscheidung über den Ausnahmezustand befreit sich der Souverän von dieser Fessel und kann in rechtlich nicht beschränkter Weise herrschen. Das Recht gilt insofern als normativer Schweif am Korpus des politischen Organismus, der in der Not abgeworfen werden kann, um das Überleben des Restes zu sichern. In der Tierwelt wird diese Fähigkeit `Autotomie´ genannt: durch das Abwerfen nicht lebensnotwendiger Körperteile können einige Lebewesen in Gefahrensituation das eigene Leben retten; die abgeworfenen Gliedmaßen können sich mitunter wieder regenerieren, wenn die Gefahr überstanden ist. In Anlehnung daran erscheint der `auto-tome´ Staat in der Ausnahmelage fähig zu sein, das eigene Überleben dadurch zu gewährleisten, dass es sich der (subjektiven) Rechte seiner Bürger entledigt. Das Recht scheint in dieser problematischen Sicht als ein verzichtbares Anhängsel des Staates. Dabei entsteht freilich keineswegs ein rechtliches Vakuum, weil sämtliche Regelungen außer Kraft gesetzt würden. Meist entsteht sogar eher eine neue Regelungsflut in einem Ausnahmezustand. Die Ausnahmeregelungen durchlaufen allerdings nicht mehr die vorgesehenen ordnungsgemäßen Verfahren. Wenn von der Suspendierung des Rechts im Ausnahmezustand gesprochen wird, so sind meist die subjektiven Rechte gemeint, deren Achtung auf dem Spiel steht. Die rechtliche Freiheit der Rechtssubjekte wird suspendiert, wenn es um den Erhalt des großen Ganzen geht. Die Auto-Nomie der Subjekte erscheint als schwächstes Glied im Staat, das im Prozess der staatlichen Auto-Tomie abgetrennt werden kann.
Das skizzierte Vorgehen im Ausnahmezustand wird gewöhnlich für die Anwendung auf Fälle von Krieg, Bürgerkrieg oder andere Beispiele eines Staatsnotstandes reserviert. Zuletzt hat diese Konzeption eines Ausnahmezustands i.S.v. Carl Schmitt im sog. `Krieg gegen den Terrorismus´ eine erstaunliche Renaissance erlebt. Ein wenig mag es den Anschein haben, als stehe das so gezeichnete Bild auch im Hintergrund der aktuellen Krise. Immerhin wird viel über die Einbußen von Freiheitsrechten diskutiert: neben der allgemeinen Handlungsfreiheit waren von den zwischenzeitlich verhängten Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen zahlreiche Grundrechte betroffen (namentlich die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit, Berufsausübung). Zwar geht es gegenwärtig nicht um die sonst üblichen Szenarien einer Ausnahmesituation, obwohl manche sogar von einem „Krieg gegen das Virus“ gesprochen haben, der freilich nur durch eine De-Mobilisierung der Bevölkerung zu gewinnen sei. Derzeit steht das politische Gemeinwesen nicht als solches auf dem Spiel, obwohl die Corona-Krise zunehmend als Herausforderung für die Demokratie verstanden werden muss. Diesmal geht es um etwas anderes – nämlich um die Funktionsfähigkeit des medizinischen Gesamtsystems, das als notwendiges Mittel zum Zweck der Rettung von Menschenleben dient. Was die Ökonomisierung des medizinischen Sektors durch den jahrelangen Sparzwang allein nicht geschafft hat, wird einer Virus-Epidemie zugetraut: das Gesundheitssystem an seine Grenzen zu bringen. Da der Systemschutz im Vordergrund steht, drohen allerdings diejenigen aus dem Blick zu geraten, um deren Schutz es eigentlich gehen sollte. Der Aspekt der Systemerhaltung hat zu einer Art `Ent-Individualisierung´ geführt, die zumindest dafür gesorgt hat, dass die Rechtssubjekte keine Wahl haben, ob sie sich freiwillig der Infektionsgefahr aussetzen möchten. Deshalb wurden beispielsweise die Personen, die zur vermeintlich besonders betroffenen Risikogruppe in Alten- und Pflegeheimen gehören, nicht gefragt, ob ihnen die zu ihrem Schutz angeordnete Isolierung tatsächlich lieber ist, als die mögliche Infektion durch den Besuch von Verwandten, Freunden oder Seelsorgern. Die Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben und die eigene Gesundheit könnte sich als unverantwortliche Belastung für das Gesundheitssystem herausstellen. Die Selbstverantwortung tritt hinter die Systemverantwortung zurück.
Hätte sich die Virus-Infektion – wie in manchen Berechnungen vorhergesagt – exponentiell entwickelt, wären nach statistischer Voraussicht wohl so viele Menschen erkrankt, dass die Krankenhäuser nicht mehr alle Patienten mit einem schweren Verlauf hätten behandeln können. Dadurch hätte die Pandemie rasch zu einer noch höheren Anzahl von Toten geführt (Um den Corona-Statistik-Teufel mal an die Wand zu malen: Bei der befürchteten Ansteckungsrate von bis zu 70% der Bevölkerung und einer Mortalitätsrate von 1% der Infizierten hätten allein in Deutschland ca. eine halbe Million Todesopfer folgen können). Um diese gravierenden Konsequenzen zu vermeiden, wurden die erwähnten Kontaktsperren bzw. Ausgangsbeschränkungen verordnet. Die massiven Freiheitsbeschränkungen wurden insofern in ähnlicher Manier begründet wie schon aus früheren Ausnahmezuständen bekannt: der Verzicht auf Freiheit sei erforderlich, um das Gesundheitssystem stabil zu halten. Die subjektiven Freiheiten werden geopfert, um die Gesundheit und das Leben von vielen Menschen zu sichern. Wenn der Gebrauch der Freiheit zum Risikofaktor wird, dann muss eben darauf verzichtet werden – so lautet eine gängige Argumentation. Insoweit scheint die Rede von einem Ausnahmezustand durchaus passend.
2. Wer entscheidet über den Ausnahmezustand?
In anderer Hinsicht erweist sich die bekannte Ausnahme-Rhetorik freilich als fraglich. Wichtig für einen Ausnahmezustand á la Schmitt ist, dass über das Bestehen der Ausnahmelage entschieden werden muss. Anders als im Recht wird diese Entscheidung nicht gefunden, sie muss vielmehr vom Souverän gefällt werden. Die souveräne Entscheidung soll sich als reine Dezision erweisen, durch die etwas entschieden wird, was zuvor gerade noch nicht entschieden ist. Nur durch eine solche Entscheidung lässt sich die Souveränität beweisen. Würde sich der Ausnahmezustand quasi von allein einstellen, müsste die souveränitätstheoretische Pointe verpuffen. Die Ausnahme ist damit nicht etwa ein Sachverhalt, der objektiv festgestellt werden könnte. Der Souveränitätsnachweis durch Ausrufung des Ausnahmezustandes hat vielmehr einen performativen Charakter. Vor der Ausführung dieses Aktes des souveränen Entscheidungsträgers existiert noch keine Ausnahme. Sie wird nämlich nicht konstatiert, sondern mit der Entscheidung selbst erst begründet. Der Nachweis der Souveränität wird gerade durch die Entscheidung über den Ausnahmezustand erbracht.
In dieser Hinsicht scheint die Corona-Krise so gar nicht zum Dezisionismus der souveränitätstheoretischen Lehre vom Ausnahmezustand zu passen. Die freiheitseinschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollten gar nicht als Akt der politischen Souveränität erscheinen. Die Politik hat die Verantwortung rasch an die Virologen abgeleitet. Die Mediziner haben diese Rolle jedoch dankend abgelehnt und auf ihre Rechenmodelle verwiesen. Mit einem virologischen Ausnahmezustand musste gerechnet werde. Die statistischen Berechnungen zur Ausbreitung einer Virus-Epidemie liegen immerhin schon seit Jahren in den Schubladen. Die Mediziner waren sich schon lange weitgehend einig, dass es zu einer solchen Pandemie kommen werde. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz im Falle einer epidemischen bzw. pandemischen Virusausbreitung waren zumindest theoretisch vorgezeichnet. Zwar scheint so mancher landesväterliche Ministerpräsident Gefallen daran gefunden zu haben, mit den Schließ-Muskeln zu spielen, um die Ausgangsbeschränkungen durchsetzen zu können. Dennoch wollte kaum einer den Eindruck vermeiden, letztlich zu den unbeliebten Maßnahmen gezwungen worden zu sein. Die medial angefeuerte Angst vor dem Virus hat sogar dafür gesorgt, dass weite Teile der Bevölkerung gleichsam den sog. `Lock-Down´ verlangt haben. Insofern macht sich die jahrelange Einübung in ein Sicherheitsdenken bemerkbar: viele Menschen möchten lieber sicher als frei sein. Die Art der Gefahr ist gleichgültig. Die Sicherung vor Terrorismus, einem Finanzkollaps, vor Flüchtlingen oder nun vor einer Viruserkrankung scheint vielen lieber als der Genuss der eigenen Freiheit. Dies lässt die Entscheidung über den Ausnahmezustand gerade nicht als reine Dezision erscheinen, wie von der entsprechenden Lehre eigentlich vorgesehen. Wer über diesen Ausnahmezustand zu entscheiden hatte, wollte nicht souverän wirken. Die Konstatierung der Ausnahme hat sich gleichsam wie von selbst aufgedrängt. Die Entscheidung über den Ausnahmezustand wurde diesmal nicht ausgerufen, sondern statistisch berechnet und medizinisch diagnostiziert. Die Politik musste das ärztlich verordnete Rezept nur noch einlösen und die bitteren Pillen verabreichen, durch die das soziale und wirtschaftliche Leben in ein künstliches Koma versetzt worden sind. Die Reanimation der Wirtschaft und mittelbar auch des gesellschaftlichen Lebens soll dann durch die Infusion einer großen Menge Geld gelingen.
III. Zur Rechtsbegründung
Nicht nur aus diesem Grund lässt sich an dem vermeintlichen Nutzen der beliebten Rede vom Ausnahmezustand zweifeln. Das Recht lässt sich weder für sich allein noch in seiner Relation zur Politik von der Ausnahme her begreiflich machen. Ein Gemeinwesen, in dem das Recht des Einzelnen als verzichtbare Größe gilt, kann nicht als Rechtsstaat bezeichnet werden. In einem Rechtsstaat kann es keine Ausnahme vom Recht geben, wohl aber gibt es Recht in Ausnahmezuständen. Die Grundrechte werden auch in Ausnahmelagen nicht suspendiert. In Notlagen geht es – ebenso wie in Normallagen – allerdings um eine Konkretisierung der Rechtsverhältnisse zwischen den Personen, die Träger von Rechten und Rechtspflichten sind. Hierfür reicht es nicht aus, lediglich abstrakte Rechtspositionen gegeneinander abzuwägen. Eine bloße Gegenüberstellung von Rechten oder `Werten´ wie Freiheit und Leben oder Freiheit und Gesundheit geht meist zu Lasten der Freiheit, da Leben und Gesundheit als vitale Basis aller Grundrechte insoweit einen allgemeinen Vorrang zu beanspruchen scheinen. Vom Leben und von Gesundheit sowie deren Verletzungen lässt sich anschaulicher reden als von den Bedrohungen der Freiheit. In der abstrakten Abwägungslogik müsste beinahe jeder Freiheitsgebrauch zurücktreten, wenn er sich als mögliche Gefährdung von Leben und Gesundheit darstellt. Das mag in dieser Abstraktheit zunächst plausibel klingen; es bleibt jedoch unzureichend, um die rechtlich verfasste Beziehung zwischen Personen zu begreifen.
Auch in politischer Perspektive wirft diese Sichtweise Fragen auf: wenn der Schutz von Leben und Gesundheit tatsächlich oberste Priorität genießen soll, dann erscheint die Gesundheitspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte verfehlt, die den medizinischen Sektor einem ökonomischen Sparzwang unterworfen hat. Im Übrigen wird auch die Entwicklungspolitik nachträglich delegitimiert. Mit einem Bruchteil des Geldes, das nun zum Ausgleich der Schäden ausgelobt wird, die durch die Corona-Maßnahmen entstanden sind und noch entstehen werden, hätten weltweit mehr Menschenleben gerettet werden können, als durch jene Maßnahmen, die die Menschen derzeit vor dem Virus retten sollen. Zudem lässt sich eine endgültige Abwägungsrechnung immer erst in Zukunft aufmachen. Derzeit wird mitunter sogar befürchtet, dass die gravierenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie am Ende womöglich mehr Menschenleben kosten werden als durch das Virus selbst zu beklagen sind. Immerhin bricht in einigen Ländern gerade die gesamte ökonomische Grundlage (Tourismus, Exportindustrie etc.) weg. Die daraus resultierenden Folgen will sich nur kaum jemand zurechnen lassen.
Wenn hingegen – im Kontrast zu dem skizzierten Abwägungsmodell – Recht im Kern als Inbegriff personaler Interaktionen aufgefasst wird, dann ist die Freiheit der Personen konstitutiv für die rechtliche Verfasstheit einer Gesellschaft. Leben und Gesundheit – sowie ein funktionierendes System zu deren Schutz – mögen zwar notwenige Bedingungen für den Gebrauch der Freiheit sein; daraus folgt jedoch nicht, dass sie deshalb einen unbedingten normativen Vorrang vor der Freiheit der Rechtssubjekte genießen. Die Bestimmung rechtmäßigen Verhaltens hat sich unmittelbar an der freiheitstheoretischen Grundlegung des Rechts zu orientieren. Rechtsverhältnisse sind dabei nicht bloß abstrakt zu bestimmen, sie müssen vielmehr in konkreten Handlungssituationen begründet sein. Das Recht hat die Interaktionen so zu bestimmen, dass jede Person eine möglichst gleich große Handlungssphäre erhält. Beeinträchtigungen der Freiheit sind stets begründungspflichtig. Der bloße Hinweis darauf, dass die Freiheitsrechte in Ausnahmesituationen nicht gelten könnten, genügt dieser Begründungspflicht nicht. Ein nicht begründbarer Übergriff in die Freiheit eines anderen bedeutet daher Unrecht. Ein solches Unrechtsverständnis lässt sich nicht beliebig erweitern.
In diesem Begründungszusammenhang kann die Verletzung oder Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens anderer Menschen als freiheitsrelevant reformuliert werden. Dies gilt zunächst für unmittelbar schädliche Verhaltensweisen. Wer beispielsweise an einer Virusinfektion leidet, muss seinen Handlungsspielraum so gestalten bzw. soweit beschränken, dass möglichst keine Ansteckungsgefahr von ihm oder ihr ausgeht. Daher können Maßnahmen wie z.B. die Auferlegung einer Quarantäne legitim sein, die diesen Schutz – ggf. auch mit Rechtszwang – gewährleisten. Geht die Gefahr indes nicht von dem Verhalten oder dem (Gesundheits-)Zustand einer Person aus, erscheint die Legitimität solcher Schutzvorkehrungen weitaus fraglicher. Die negative Pflicht, andere nicht zu schädigen, lässt sich nicht ohne Weiteres zu einer positiven Verpflichtung, zum Wohl der Allgemeinheit beizutragen, umdeuten. Prinzipiell ist jeder nur für den eigenen Aktionskreis zuständig. Eine unmittelbar handlungswirksame Rechtspflicht zur Mitwirkung an der Erhaltung von Gemeinschaftsaufgaben ist gesondert zu begründen; sie ist nur unter engen Voraussetzungen möglich. Eine freiheitstheoretische Reformulierung des Rechtsbegriffs muss dabei auch die Grenzen der Inanspruchnahme von Personen aufzeigen, soweit es um eine Vorverlagerung der Gefahrenlagen geht. Hierbei stellt sich etwa die Frage, ob und wie sich die verhaltensrelevante Verpflichtung von Menschen begründen lässt, um den Schutz des Gesundheitssystems gewährleisten zu können. Hierbei ist zu beachten, dass medizinische Schutzvorkehrungen kein Selbstzweck sind, sondern lediglich Mittel zum Zweck, um die vitale Basis des Freiheitsgebrauchs zu gewährleisten. Grundsätzlich erweist es sich als gesellschaftspolitische Aufgabe, das Gesundheitssystem so stabil zu gestalten, dass es Epidemien widerstehen kann. Obwohl durchaus mit pandemischen Krankheitsverläufen gerechnet werden konnte, waren die national organisierten Vorkehrungen offenbar nicht hinreichend, um ein starkes Ansteigen der Infektionen zu bewältigen. Daher wird die Bevölkerung in der aktuellen Lage durch Preisgabe eines großen Teils der eigenen Freiheitssphäre zur Mitwirkung verpflichtet. Dies bedingt massive Verhaltensänderungen. Da theoretisch jede Person an der Verbreitung des Virus beteiligt sein kann, wird sie als potentielle Infektionsgefahr eingestuft.
Einzelpersonen sind unter normalen Umständen nicht unmittelbare Garanten für den Bestand dieses Systems. Die Funktionsfähigkeit der Krankenversorgung kann und muss nicht um jeden Preis die oberste Priorität erhalten. Daher stellt sich durchaus die Frage, ob Menschen ihre ökonomische Grundlage aufopfern und das soziale Miteinander aufgeben müssen, um nicht zu einem Gefahrenpotenzial für die Funktionstüchtigkeit des Gesundheitssystems zu werden. In der aktuellen Krise lässt sich jener Trend beobachten, der bereits in vorherigen Ausnahmezuständen sichtbar geworden ist: die Eingriffe in die Freiheiten der Bürger werden durch eine Ausweitung des Gefahrenbegriffs begründet. Nicht mehr nur die direkten konkreten Gefahren, die von einem bestimmten Handeln für andere Menschen ausgehen, bestimmen eine Einschränkung der Handlungsspielräume, sondern schon die Gefahr einer Gefahr soll genügen. In der gegenwärtigen Lage wird quasi jeder Mensch unvermittelt zum Garanten für den Bestand der Funktionstüchtigkeit der medizinischen Versorgung erklärt, weil er möglicherweise als Träger einer Krankheit zur Gefahr des Gesundheitssystems werden könnte; jeder kann der Tropfen sein, der das Fass der medizinischen Belastbarkeit zum Überlaufen bringen kann. So wird die Hemmung eines an sich naturhaften Krankheitsverlaufs in Kollektivverantwortlichkeit überführt. Hierbei entsteht eine gewagte Konstruktion der Zuschreibung von Verantwortlichkeit. Die kollektive Verantwortung entsteht quasi durch die Enteignung der eigenverantwortlichen Bürger, die nicht mehr über das Maß ihrer Selbstgefährdung entscheiden können. Da die Begründung der Freiheitseinschränkungen über den Systemschutzgedanken vermittelt wird, soll niemand selbst darüber befinden, ob er sich der Infektionsgefahr selbst aussetzen will.
Nun wird vielfach darauf hingewiesen, dass die gravierenden Maßnahmen zumindest in Deutschland von einem relativen Erfolg gekrönt wurden, da die Todeszahlen im Vergleich zu anderen Ländern gering geblieben sind. Dies genügt vielen bereits, jedwede Kritik daran als zynisch zu kennzeichnen. Die Rettung einer unbekannten Anzahl von Menschenleben gilt insofern bereits als Legitimationsbeweis. Allerdings dürften einige derjenigen, die nun vor dem finanziellen Ruin stehen, es ebenfalls als Zynismus ansehen, wenn ihr ökonomisches Schicksal als Rechenposten im Kosten-Nutzen-Kalkül unterzugehen droht. Für die Zukunft dürfte klar sein, dass wir uns – weder wirtschaftlich noch sozial – eine derartige Pandemie-Bekämpfung nicht allzu oft werden leisten können. Daher lässt sich die Frage nach der Legitimation der freiheitseinschränkenden Maßnahmen nicht dauerhaft mit dem Gesundheitssystemschutz und einem gut gemeinten Lebensrettungsmotiv abspeisen.
Mit der Möglichkeit, an Krankheiten zu sterben, müssen wir leben.