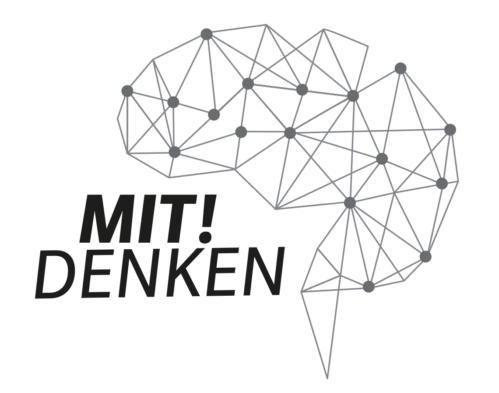2020 wird als historisches Datum in die Geschichte eingehen. Zum ersten Mal in mehr als 2000 Jahren fanden keine Osterfeierlichkeiten statt. Auch Pessach-Feiern mussten ausfallen und der Fastenmonat Ramadan konnte nicht wie gewohnt mit großen Feierlichkeiten zum Fastenbrechen begangen werden. Dies ist einzigartig in der Geschichte, die durch Kriege, Weltkriege, Pestepidemien und andere Katastrophen gekennzeichnet ist. Nach Gesprächen zwischen Bundesregierung und Religionsvertretern dürfen seit Anfang Mai in allen Bundesländern unter strikten Auflagen wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden.
In Deutschland ist die Religionsfreiheit in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verankert. Durch die Religionsfreiheit geschützt sind insbesondere auch die Teilnahme und das Abhalten von Gottesdiensten und anderen religiösen Feiern. In den Rechtsverordnungen der Länder zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie wurden weitreichende Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängt sowie Veranstaltungen und sonstige Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen, Moscheen und Gotteshäusern anderer Religionsgemeinschaften untersagt. Eingriffe in das Grundrecht auf Religionsfreiheit sind nach deutschem Verfassungsrecht zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, dem Schutz kollidierender Verfassungsrechtsgüter dienen und sich als verhältnismäßig erweisen. Mit § 28 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 32 S. 1 IfSG existiert eine solche Rechtsgrundlage, die entsprechende Verbote zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung grundsätzlich zulässt. Fraglich ist jedoch, ob die pauschalen Gottesdienstverbote auf unbestimmte Zeit, so wie sie in den Rechtsverordnungen der meisten Bundesländer wochenlang vorgesehen waren, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen.
Festzuhalten ist zunächst, dass es im Hinblick auf die Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus auf jeden Fall erforderlich war, Gottesdienste im gewohnten Rahmen zu untersagen, da in vollen Gotteshäusern eine Übertragung des Corona-Virus sehr leicht möglich erscheint. Bei dem vollständigen Verbot jeglicher Gottesdienste blieb es dann aber erst einmal, ohne dass die großen Kirchen im Dialog mit der Bundesregierung und den Landesregierungen im Vorfeld von Ostern nach Ausnahmen oder Alternativen gesucht hätten. Lediglich traditionalistische Strömungen der katholischen Kirche wie der „Freundeskreis St. Philipp Neri“ in Berlin wandten sich gerichtlich gegen die entsprechenden Verbote, jedoch ohne Erfolg (VG Berlin, Beschluss vom 07.04.2020 – VG 14 L 32/20). Letzteres ist unter juristischen Gesichtspunkten nicht weiter verwunderlich, da zum Zeitpunkt des bisherigen Höhepunktes der Corona-Pandemie in Deutschland kein vernünftiger Mensch befürworten konnte, dass in einer doch vergleichsweise großen Runde mit bis zu 50 Personen Eucharistie unter Einschluss der Mundkommunion gefeiert wird.
Aber ist es wirklich so, dass es keine Alternativen gab zu einem kompletten Gottesdienstverbot einerseits und einem unvernünftigen Verlangen nach Gottesdiensten einschließlich der Mundkommunion andererseits? Tertium non datur? Mitnichten! Es hätte sehr wohl Alternativen zu einem vollständigen Gottesdienstverbot gegeben, das gerade in Zeiten der Angst und der Bedrängnis für viele Gläubige, die in der Teilnahme an religiösen Feiern Trost und Orientierung finden, als zusätzliche Belastung empfunden wurde. Möglich gewesen wären, wie nunmehr nach Lockerung der Corona-Vorschriften, Gottesdienste im ganz kleinen Rahmen unter strengen Auflagen auf Grundlage eines Hygienekonzeptes, welches von den Religionsgemeinschaften erstellt und von staatlicher Seite überprüft wird.
Bereits bei den Ostergottesdiensten, die von Papst Franziskus in Rom zelebriert wurden, war ein kleiner Kreis von Gläubigen stellvertretend für die ganze Gemeinde anwesend. Eine solche Beteiligung hätte sich auch in Deutschland realisieren und schrittweise erweitern lassen. Auch durch ein vermehrtes Angebot von Gottesdiensten, sowohl an Sonn- als auch an Werktagen, hätte den Gläubigen die Teilnahme schon früher wieder ermöglicht werden können.
Dagegen ließe sich einwenden, dass es doch hinreichend Gottesdienstübertragungen im Fernsehen und im Internet gab und gebe und im Übrigen ja jeder und jede zu Hause für sich beten könne. Wer so argumentiert, verkennt jedoch, dass aus theologischer Sicht die Anwesenheit einer Gemeinde – und sei sie noch so klein – bei einem Gottesdienst erforderlich ist, zumal sog. „Geistermessen“, bei denen der Priester in der Kirche vor leeren Bänken zelebriert, nicht dem heutigen Verständnis von Liturgie entsprechen. Bei rein medialen Gottesdiensten sind Menschen „zusammen und doch nicht zusammen“, wie Papst Franziskus zu Recht betont. Der Staat darf sich jedenfalls nicht anmaßen, selbst zu entscheiden, was zu den Grundüberzeugungen einer Religionsgemeinschaft gehört und was für die Feier von Gottesdiensten erforderlich ist und was nicht. Im Übrigen ist zu bedenken, dass nicht alle Gläubigen über Zugriffsmöglichkeiten zu den medialen Angeboten verfügen und sich bestimmte Formen der religiösen Feier wie etwa das Fastenbrechen zum Ende des Ramadan nur schwer medial ersetzen lassen werden. Daher erscheint ein unbefristetes Totalverbot von Gottesdiensten auch unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit als unverhältnismäßig. Die Notwendigkeit, über Lockerungen nachzudenken, legte dementsprechend auch das Bundesverfassungsgericht in einer Eilentscheidung nahe, indem es anmerkte, dass bei jeder Fortschreibung der Corona-Verordnungen mit Blick auf den mit einem Gottesdienstverbot verbundenen überaus schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit eine strenge Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfolgen und untersucht werden müsse, ob es angesichts neuer Erkenntnisse etwa zu den Verbreitungswegen des Corona-Virus oder zur Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems verantwortet werden könne, das Verbot von Gottesdiensten unter – gegebenenfalls strengen – Auflagen und möglicherweise auch regional begrenzt zu lockern.
Inzwischen finden fast überall wieder Gottesdienste mit Gläubigen statt, nachdem die Religionsgemeinschaften und ihre Einheiten vor Ort Schutzkonzepte vorgelegt haben, die u.a. eine Begrenzung der Teilnehmerzahl pro Gottesdienst, hinreichend große Abstände zwischen den Gläubigen, besondere Hygienemaßnahmen beim Kommunionempfang sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Maske durch alle Gläubigen während des Gottesdienstes vorschreiben. Die Wiederaufnahme der öffentlichen Gottesdienste wird von den Religionsgemeinschaften und den Gläubigen begrüßt, auch wenn bestimmte Elemente wie das Niederwerfen der Gläubigen auf den Boden während des muslimischen Gebetes in der Moschee aus Hygienegründen vorerst weiterhin nicht in gewohnter Form stattfinden können.
Dass die Wiederaufnahme der öffentlichen Gottesdienste Anfang Mai realisiert werden konnte, war ein wichtiger Schritt, um der grundrechtlich geschützten Religionsfreiheit Rechnung zu tragen.
Die Vertreter der Religionsgemeinschaften (wie etwa die Deutsche Bischofskonferenz) hatten sich mit Forderungen lange zurückgehalten, weil sie sich verständlicherweise nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, für ein Wiederansteigen der Infektionsrate verantwortlich zu sein. Leitend war hierbei die Überzeugung, dass die christliche Grundhaltung der Nächstenliebe sich im Verzicht auf Gottesdienste am besten realisieren lasse. Zudem scheinen die Religionsgemeinschaften bzw. Konfessionen teilweise auch überfordert zu sein, wenn es darum geht, neue situationskompatible Gottesdienstformenzuzulassen. Dazu gehört etwa, dass im Fall der katholischen Kirche auf die Kommunionspendung durch den Priester und damit auf potentiellen Körperkontakt verzichtet wird und die Gläubigen die Hostie stattdessen schon an ihrem Sitzplatz vorfinden.
Was passiert aber, wenn die von Wissenschaftlern befürchtete „zweite Corona-Welle“ tatsächlich eintrifft, sich möglicherweise noch mehr Menschen infizieren als in diesem Frühjahr und ein erneuter Lockdown droht? In diesem Fall sollte auf die Bedeutung der Religionsfreiheit noch stärker Rücksicht genommen und genau geprüft werden, ob ein pauschales Verbot aller öffentlichen Gottesdienste tatsächlich erforderlich ist. Ein solches Verbot müsste unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten künftig auf jeden Fall von Anfang an zeitlich befristet werden. Außerdem müsste im Falle eines erneuten Verbots den Religionsgemeinschaften ein Zeitplan in Aussicht gestellt werden, wann wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden dürfen, denn es ist unter Gleichheitsgesichtspunkten schon etwas befremdlich, wenn etwa für die Wiederöffnung des Autohandels, die bei Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen kaum als vordringlich angesehen werden kann, in den Rechtsverordnungen der Länder ein sehr frühes und konkretes Datum genannt wird, die Religionsgemeinschaften aber lange Zeit vertröstet werden. Die Religionsgemeinschaften selbst könnten ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten, indem sie Gottesdienstbesucher namentlich registrieren und so im Falle des Auftretens eines Infektionsfalles den Gesundheitsämtern die Nachverfolgung der Kontaktpersonen erleichtern. Situationen wie die jüngst in Frankfurt am Main, wo sich beim Gottesdienstbesuch in einer Baptistengemeinde Dutzende Menschen infiziert haben, auf Grund mangelnder Registrierung der Gottesdienstbesucher Kontaktpersonen jedoch nur schwer ausfindig gemacht werden können, sollten vermieden werden. Dass bei der Registrierung der Gottesdienstbesucher der Datenschutz zu wahren ist und die gesammelten Daten nach zwei Wochen zu löschen sind, sollte selbstverständlich sein und einer expliziten Regelung unterliegen. Insoweit besteht vielerorts noch Nachholbedarf. Schließlich wird während der gesamten Dauer der Pandemie und insbesondere im Fall eines erneuten Lockdowns die Kreativität der Religionsgemeinschaften gefragt sein, wenn es darum geht, sich von dogmatischen Fesseln zu lösen, um durch ein entsprechend hygienebewusst ausgestaltetes Gottesdienstangebot den Bedürfnissen der Gläubigen nach Trost und Beistand Rechnung zu tragen.